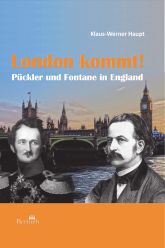Er liebte die Blumen von Corinth – der Maler Bernhard Heisig (1925 – 2011)
01. Meine Hypothese
Gegen Mittag hatte das Bildermuseum zum Presserundgang geladen. Journalisten eilen zur Katharinenstraße 10. Dem Maler und Grafiker Bernhard Heisig ist zum 100. Geburtstag am 31. März 2025 eine Kabinettausstellung gewidmet. Ich kam pünktlich genug, um am 19. März die Eröffnung der Ausstellung durch Stefan Weppelmann – den Direktor des Museums - zusammen mit den beiden Kuratoren Philipp Freytag und Dietulf Sander sowie mit Jana Hecht, der Vertreterin der Peter und Irene Ludwig Stiftung, zu erleben. Seit dem Wechsel in den beruflichen Ruhestand male ich in der Kunstkapelle auf dem Alten Friedhof zu Schkeuditz. Malen ist seit einem Jahrzehnt mein Altershobby geworden. Bisher habe ich es durch den Mangel an Wissen und durch das Fehlen von persönlichen Kontakten nicht gewagt, über die aus drei Maler-Generationen bestehende Leipziger Schule zu schreiben. Ermuntert wurde ich jedoch durch die Eröffnung der Ausstellung Geburtstagsstilleben mit Ikarus für Bernhard Heisig. Auf dem Weg ins große Bilderquartier im Zentrum der Stadt hatte ich eine Hypothese im Kopf. Mir scheint, dass von Schellings früher Ontologie der Malerei, ein realer und für eine moderne Philosophie der Malerei höchst wichtiger Pfad bis hinein in das Leipziger Atelier des Malers Heisig führt, in dem sich der Kunstkenner Helmut Schmidt im Jahr 1986 in aller Ruhe hat porträtieren lassen.
02. Ohne Fragen keine Antworten
So ein Pressetermin ist ein Fest des Arbeitens und kein Ort zum Chillen. Ich hatte Freude daran, das auffallend rege Treiben mitzuerleben, ohne dabei einen festen journalistischen Auftrag im Nacken zu haben. Vor allem drei Themenkreise hatte ich im Kopf, als ich an dem Rundgang durch die drei großen Räume mit Heisig-Bildern teilnahm: (1.) In meinem journalistischen Leben habe ich über die Schule der Quantentheorie des Atoms von Werner Heisenberg ebenso geschrieben wie über die Schule der Paläogenetik von Svante Pääbo, die beide Nobelpreise nach Sachsen geholt haben. Heisenberg 1933 und Pääbo 2022. Dadurch hatte ich die folgende Frage: In welchem Sinne ist die Leipziger Schule der Malerei, die während ihrer ersten Generation mitten in der DDR um Heisig entstand, im Sinne des Philosophen Thomas S. Kuhn als eine soziale Gruppe oder als eine intellektuelle Gemeinde oder als eine geistvolle Verbindung anzusprechen, die nun nicht in der Wissenschaft, dafür aber in der Kunst mit sichtbarer Resonanz Neuartiges geschaffen hat? Auch wenn die Künstler dieser Schule keineswegs einheitlich gemalt haben, ist mit philosophischer Brille danach zu fragen, inwiefern sie neue Sichten, ungewohnte Farbklänge und unerwartete Wirkungen in der Welt der Kunst auslösten? Eine zweite Überlegung begleitete mich in die Kabinettausstellung: (2.) Sowohl in der Ästhetik von Hegel als auch von Schelling wird davon gesprochen, dass „die ästhetische Produktion von Freiheit ausgeht“. Hielt Schelling in Person von Adam Friedrich Oeser den einstigen Zeichenlehrer von Goethe für einen in seinen Allegorien starken Maler, was würde er nun heute über Bernhard Heisig sagen, wenn er mit den Kuratoren und mit Stefan Weppelmann vom 20. März bis zum 09. Juni 2025 durch die Ausstellung flanieren könnte? Schließlich kroch mir bei dem Rundgang eine aus meinem Hobby erwachsende Überlegung in den Kopf: (3.) Beim Malen von Meer und Blumen schaute ich mich bisher vor allem bei Emil Nolde in Seebüll um, von dem ich mich durch seine exzessiven Farbideen angesprochen und angeregt fühle. Daraus erwuchs die einfache Frage: Malte Bernhard Heisig während der langen Leipziger Schaffensphase auch Blumen und Blumensträuße?
03. Geburtstagsstilleben mit Ikarus (1985)

Nach der Führung durch die drei Räume ging ich auf den Direktor des Bildermuseums zu und fragte ihn, ob ich ihn vor seinem Lieblingsbild der Ausstellung fotografieren dürfe. Stefan Weppelmann nahm mich zu der Arbeit von Heisig mit, die von den Kuratoren ausgewählt worden war, um dem Leipziger Maler, Zeichner und Grafiker mit einem Werk von ihm selber zum 100. Geburtstag zu gratulieren. Zu sehen ist eine bunte wie grüne Fülle aus Blumen und Sträußen, doch im Zentrum des Bildes zieht Ikarus die Aufmerksamkeit auf sich, der auf vielen Bildern von Heisig dargestellt ist. Bei der Führung hatte Philipp Freytag herausgearbeitet, dass Ikarus bei Heisig für den Künstler oder die Künstlerin steht. Aufsteigend in die Höhe und gefährdet von einem tödlichen Absturz. Hin und hergerissen zwischen Euphorie und Depression bin ich als Malamateur auch bei meinen Bildern, die nicht immer gelingen und in großer Enttäuschung enden können. Beim Ikarus dachte ich aber auch an mein berufliches Scheitern. Das lag an dem Heisig-Gemälde, zu dem mich Stefan Weppelmann zuerst geführt hat. Das Bild entstand im Jahr 1985 in Leipzig. Ich war damals junger Doktor der Philosophie, der gerade seine B-Dissertation über die philosophische Diskussion zur Physik in der Presse der alten Sozialdemokratie verteidigt hatte. Wir wurden als Philosophen der damaligen Karl-Marx-Universität in die politische Praxis geschickt. So leitete ich im Baukombinat Leipzig ein Parteilehrjahr zum Dialektischen und Historischen Materialismus. Im Frühjahr 1983 hielt ich aus Anlass des 100. Todestages von Karl Marx im Baukombinat auch einen Vortrag über den sogenannten Begründer der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse. Meinen Vortrag begann ich nicht mit Karl Marx, sondern mit meinem Vater, der im Todesjahr von Marx im Brandenburgischen das Licht der Welt erblickt hatte. Die Genossen wunderten sich, aber ich hatte nur die Wahrheit erzählt. Nicht nur ich hatte persönliche Beziehungen in das Baukombinat, sondern auch Heisig, wie ich jetzt durch die Kabinettausstellung lernen kann. Auf der Unterschrift zum Geburtstagstilleben mit Ikarus ist zu lesen: „Schenkung der Ersten Baugesellschaft Leipzig AG 1995“. Die Baugesellschaft AG war die Nachfolgeeinrichtung des Baukombinats Leipzig. Ich bin in meinem Leben mit dem Glauben an Marx als dem Gründungsvater des kommunistischen Projekts nicht allein, sondern mit weiten Teilen meiner Generation wie ein Ikarus abgestürzt und musste wie ein Kind von vorn beginnen. Aber dass man nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Politik, in der Philosophie, in der Wissenschaft und nicht zuletzt in der Wirtschaft und in der Religion oder in der Liebe nach der Geburtstagsfeier immer noch abstürzen kann, das hat Heisig uns allen im Jahr 1985 mit seinem Werk auf stimmige Weise erzählt. Er selbst durchlebte die Erfahrung von Absturz und Schuld als Panzersoldat des Zweiten Weltkrieges auf dramatische wie traumatische Weise. In seinen Bildern hat Heisig das Kriegserleben – wie der Kurator Dietulf Sander auf ergreifende Weise erläuterte - bis hin zur Ansicht hell leuchtender Menschenleichen auf Schlachtfeldern bearbeitet und in Farbe verarbeitet. Er hat als Künstler versucht, über Krieg zu sprechen und dabei aber so zu malen, dass die Toten als Mahnung verstanden werden können, die sich anbahnenden neuen Kriege der Völker gerade auch in Europa möglichst abzuwenden. Wer den ersten Raum der Ausstellung betritt, schaut geraden Schritts auf das Bild Als ich die Völkerschlacht malen wollte II (1984/1985) aus den Beständen des Museums der bildenden Künste in dem Großformat 151, 5 cm x 203 cm.
04. Helmut Schmidt im Atelier von Heisig
Im Jahr 1986 erfüllte Heisig dem Politiker Helmut Schmidt in aller Stille einen Wunsch. Er porträtierte den Kanzler der Bundesrepublik. Beim Presserundgang waren bei diesem Bild alle Mikrofone eingeschaltet. Schmidt schaut in die Höhe, als würde er sich in Heisigs Atelier in einem Wald von Bildern befinden. Die Betrachter sehen einen Schmidt, der leibt und lebt, der schaut und denkt. Ich musste mich beim Anblick von Schmidt zurückhalten. Gern hätte ich gefragt: „Herr Bundeskanzler hätten auch Sie sich von der erregten Presse wie Ihre Kollegin Angela Merkel im April 2019 dahin drängen lassen, das Meerbild 'Brecher' mit dem roten Himmel von Emil Nolde im Arbeitszimmer des Kanzleramtes einfach abzuhängen?“ Das tat eine starke Frau, von der die Ostsee in Dierhagen seit der Kindheit bis heute zutiefst geliebt wird. Zur Zeit des Bildabhängens wurde von der Nolde Stiftung Seebüll in einem Film längst ausführlich darüber aufgeklärt, dass Nolde sowohl ein großartiger expressionistischer Künstler als auch ein tief in die völkische Ideologie des Nationalsozialismus verstrickter Maler war. Obwohl seine Bilder im NS-Staat abgehängt wurden, huldigte Nolde wie viele Frauen und Männer seiner Generation – wie auch der blutjunge Heisig – dem Führer-Kult. Wenn man sich für den Christus-Zyklus in Seebüll begeistert, muss man sich nun aber noch lange nicht auf das völkische Denken einlassen, auf das Nolde reinfiel. Ich vermute, dass sich der selbstbewusste wie ruppige Norddeutsche Schmidt es sich nicht hätte einreden lassen, ein Meerbild wie den „Brecher“ aus dem Arbeitszimmer des Kanzlers oder der Kanzlerin zu verbannen. Schmidt machte sich auch nichts daraus, die malende Elite des Westens links liegen zu lassen, um sich für sein Kanzlerporträt still und leise in den Osten, in die DDR, in die Zone, in den Honecker-Staat, in das SED-Regime zu begeben. Sein Kommentar über Heisig lautete auch später unbeirrt und souverän: „Als das wiederhergestellte Gebäude des alten Reichstages ausgemalt werden sollte, haben einige Anti-Kommunisten Heisig etwas kleinlich-rechthaberisch davon ausschließen wollen. Jedoch hatten sie weder die philosophische Unabhängigkeit Heisigs begriffen noch die Qualität seiner Bilder. Er bleibt – vergleichbar dem Spanier Goya zu seiner Zeit – ein großer Maler des die Deutschen erschreckenden zwanzigsten Jahrhunderts.“ (S. 41.)
05. Mit Kuhn-Brille auf Leipziger Schule schauen

Es ist nicht zu übersehen, dass Helmut Schmidt einen Blick für Malerschulen gehabt hat, die den Tag überdauern. In seinem Urteil über den Maler Heisig könnte genau der Fingerzeig liegen, den ich suche, wenn ich darüber nachgrüble, ob eine Brücke von Thomas S. Kuhns Bestseller über Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (1962) rüber nach Europa, hindurch durch den Eisernen Vorhang, hin nach Sachsen und hinein in Heisigs Leipziger Atelier führt. Bezogen auf die Physik von Einstein, Bohr und Heisenberg erarbeitete Kuhn zwei wichtige Gesichtspunkte bei der Analyse des Entstehens von Neuem in der Wissenschaft: Erstens Neues wächst nicht nur kontinuierlich, sondern es gibt immer Diskontinuität und das heißt unerwartete Sprünge ins Ungewohnte. Kuhn sprach von Paradigmenwechseln. Zweitens zeigte Kuhn auf, dass Neues von Menschen aus sozialen Gruppen, aus gesellschaftlichen Milieus heraus gemacht wird. Beides ist nun aber auch in der Kunst der Fall, zumal nicht zuletzt Maler ihr Schaffen in sozialen Netzwerken entfalten. Um mit der Kuhn-Brille den Wechsel von der Wissenschaft zur Kunst zu vollziehen, muss ich nicht lange rumspekulieren, sondern ich kann einfach nur das Buch aufschlagen, dass Stefan Weppelmann und Philipp Freytag bei der Eröffnung der Kabinettausstellung hochgehalten haben: Herausgegeben von Heiner Köster umfasst das Buch Erinnern und verantworten. Bernhard Heisig zum 100. Geburtstag 328 Seiten. Es ist ein in Leinen gebundener Text-Bild-Band mit 175 Farbabbildungen und 36 Schwarz-Weiß-Abbildungen. Die Presseinformation vom E. A. Seemann Verlag in Leipzig erzählt verständlich und präzis: „Bernhard Heisig zählte mit Werner Tübke und Wolfgang Mattheuer zu den Begründern der Leipziger Schule. Lange als Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst tätig, galt der preisgekrönte, gefeierte, mit Aufträgen bedachte Heisig als eigen und streitbar. Wie seine Vorbilder Otto Dix, Max Beckmann und Oskar Kokoschka suchte auch er nach einer Bildersprache, um die Grauen der Kriegszeit zu thematisieren. Immer wieder kreisen die Themen um Schuld und Krieg. In seinen Porträts jedoch – u. a. das von Kurt Masur und Helmut Schmidt – zeigt sich sein mitfühlender Blick auf den Menschen.“
06. Heisig – ein Beförderer von Gruppendynamik
Der Herausgeber Heiner Köster war mit Heisig befreundet und ist ein Sammler seiner Werke. Er hat das Ehrenamt als Vorsitzender der Eugen-Biser-Stiftung inne. In dem Buch Erinnern und verantworten wird meine Frage nach dem logischen Status der Leipziger Künstlerschule um Heisig wie folgt beantwortet: „Die in Leipzig tägigen Maler Heisig, Mattheuer, Tübke und hervorragende Absolventen der HGB werden nicht wegen einer einheitlichen Malweise, die es nie gab, sondern wegen ihrer Exzellenz und des gemeinsamen Ortes ihres künstlerischen Arbeitens seit Ende der 1960er Jahre als Mitglieder der Leipziger Schule bezeichnet.“ (S. 231.) Von dieser Einschätzung der Leipziger Schule führt ein kurzer Weg zu Hegel, bei dem in der Ästhetik, die sein Schüler Hotho aus dessen Vorlesungen zur Philosophie der Kunst denkend zusammenbaute, über die geistvolle künstlerische Praxis nur gesagt wird: „Die Freiheit ist die höchste Bestimmung des Geistes.“ - Wichtig ist nun aber auch, wie sich Heisig selbst geäußert hat. Heiner Köster referiert in seinem Essay Bernhard Heisig im Spiegel seiner Zeit die Sicht des befreundeten Schulengründers: „Heisig sieht die Bezeichnung Leipziger Schule pragmatisch. Er meint, 'so heißt es nun mal', und zitiert Tübke mit den Worten: 'Wir lieben uns nicht gerade, aber wir tolerieren und achten einander.' Heisig stellt klar: 'Das ist schon viel und bei Künstlern nicht sehr häufig anzutreffen.'“ (S. 231.) Heiner Köster unterstreicht die zutiefst freiheitliche Veranlagung seines Freundes in der Malerei noch mit den kommentierenden Worten: „Die unterschiedlichen Malstile – expressiv, neusachlich, altmeisterlich lasierend, surrealistisch – zeigen in kontroverser Gruppendynamik die Vielfalt der Leipziger Schule.“ (S. 232.) - Ob Heisenbergs Gruppe in Leipzig, ob Pääbos Gruppe in Leipzig, ob Heisigs Gruppe in Leipzig – alle diese geistigen Gemeinschaften kreativen Schaffens waren das, was Heiner Köster nun speziell über Heisigs Leipziger Schule formuliert: Ein Ort und geistiger Raum „kontroverser Gruppendynamik“. Beim Nachdenken über Schulen in Kunst wie Wissenschaft und über ihre kulturelle Wucht macht es nun aber einen nicht geringen Unterschied, ob eine Schule nur über eine Generation geht, wie im Fall von Heisenbergs Leipziger Schule der Physik, oder über drei Generationen, wie im Fall von Heisig und Kollegen in der Malerei. Der Kunstkritiker Eduard Beaucamp legt den Finger auf diesen wichtigen Punkt. Den Begriff Leipziger Schule bezieht er auf drei Künstlergenerationen und erläutert ihren besonderen kulturellen Effekt: „Der stupende Reichtum dieser Schule resultierte aus dem spannungsgeladenen Zusammenspiel, der Gruppendynamik dreier denkbar gegensätzlicher Lehrer – des expressiven, ja vulkanischen Temperaments Heisigs, des einerseits neusachlichen, aber auch romantischen Parabelmalers und Analytikers Mattheuer und des virtuosen Manieristen und Geschichtsvisionärs Tübke. Im Werk der Schüler lassen sich deutlich die Spuren und Eindrücke der drei Lehrer in wechselnden Konstellationen verfolgen.“ (S. 233.)
07. Verblühte Chrysanthemen
Nachdem mir der Direktor des Bildermuseums den Ikarus inmitten der Blumensträuße im Titelbild der Ausstellung gezeigt hatte, fragte ich ihn, ob er mir nun von Tüpke auch ein Blumenbild ohne Symbole zeigen könne. Stefan Weppelmann ging im ersten Ausstellungsraum in die rechte Ecke neben dem Eingang. Er machte darauf aufmerksam, dass es nicht einfach nur Pflanzen sind, denen sich Heisig in diesem Bild gewidmet hat, sondern dass es sich um ein Stilleben mit verwelkten Chrysanthemen (1972) handelt. Er betonte bei der Nennung des Titels das Wort verwelkt. Mir kam zuerst Vincent van Gogh in den Sinn, der auch abgeschnittene und dahinsiechende Sonnenblumenblüten gemalt hat. Aber vor allem musste ich an Nolde denken. Der expressionistische Maler bekannte sich noch im Alter zu seiner Passion: "Ich liebte die Blumen in ihrem Schicksal: emporsprießend, blühend, leuchtend, glühend, beglückend, sich neigend, verwelkend, verworfen in der Grube endend." Nicht nur Menschen-Sein, auch Pflanzen-Sein ist ein Sein zum Tode, zumal alles Lebende zeitlich verfasst ist. Menschen wissen um das Sein zum Tode. Die Zeitlichkeit der Existenz wird nicht nur in der Wissenschaft, sondern vor allem in der Religion und in der Philosophie, aber gerade auch in der Kunst bedacht. Als ich nach dem Blick auf die verwelkten Chrysanthemen den Weg nach Hause antrat, traf ich am Fahrstuhl auf einen Herrn mit weißen Haaren. Wir unterhielten uns im halbdunklen Fahrstuhl über Blumenmalerei. Ich fragte, ob Heisig bei seinen Stilleben von Nolde beeinflusst gewesen sei. Mein Gesprächspartner verneinte das und sagte, dass Heisig die Blumen anders gemalt habe. "Ja, aber inwiefern anders," fragte ich. Darauf erhielt ich die erhellende Antwort zu Heisigs floraler Denkart: "Er liebte die Blumen von Corinth." Schnell fragte ich, wo ich das geschrieben finden können. "Na, in meinem Buch," sagte mein Gegenüber. Jetzt musste ich unbedingt wissen: "Und wie heißen Sie?" "Köster", war die Antwort. Gleich noch am Nachmittag rief ich im Seemann-Verlag bei der Programm-Leiterin Caroline Keller an. Sie half prompt. Sogleich hatte ich das Buch im Computerbildschirm, das zu Beginn des Rundgangs von Stefan Weppelmann und Philipp Freytag in die Höhe gehalten worden war. Jetzt las ich in dem Essay von Heiner Köster: „Über die Blumen sagt Heisig: 'Ich begriff, dass Blumen als Bildstoff nicht nur schön, sondern auch voller Angst, auch voller Aggressionen sein können; dass sie mörderischer wirken können als eine dargestellte Mordszene. Später sah ich Beispiele beim alten Corinth.'“ (S. 177.) Heiner Köster kommentiert das Heisig-Zitat mit den Worten: „Auf jeder Wiese lasse sich der Riss, der durch die Schöpfung geht, hinter jedem Gartenzaun aufspüren, alles sei ein Gleichnis für alles, die Pariser Kommune genauso wie die Dorfstraße im Regen." (S. 177/178.)
08. Nachklang zum Besuch im Bildermuseum
Durch den Rundgang durch die Ausstellung, durch das kurze Kennenlernen des Direktors des Bildermuseums, durch das kleine Gespräch mit Heiner Köster und durch die erste Lektüre des Gedenk-Bandes zum 100. Geburtstag von Bernhard Heisig konnte ich an einem Tag enorm viel lernen. Als ich am Tag darauf den Entwurf dieses Berichts verfasst habe, blühten gerade die Osterglocken auf. Am 21. März 2025 nahm ich mir den Pinsel und aquarellierte im Format 20 cm x 20 cm Schräge Osterglocken, um sie bei Instagram @farberlebnisse auszustellen. Beim Malen musste ich an Heisig's verwelkte Chrysanthemen denken und an den Satz seines Freundes Heiner Köster. Denn: Auch das Malen von Blumen war ein Themenkreis, dem Heisig in seiner Kunst zu besonderer Meisterschaft verhalf. Er suchte die Rhythmik von Menschen- und Pflanzen-Schicksal auf unserem Heimatplaneten Erde zu entdecken und in seinen Bildern aufzuzeigen. Diese Erkenntnis vom 19. März 2025 im Bildermuseum zu Leipzig wird mich für den Rest meines Lebens beim Malen dankbar begleiten, denn Heisig liebte die Blumen von Lovis Corinth.
24. März 2025.
*****
Alle Seitenangaben im Text beziehen sich auf den Heisig-Gedenk-Band:
Heiner Köster (Herausgeber): Erinnern und verantworten. Bernhard Heisig zum 100.Geburtstag. 328 Seiten. Hardcover, Leineneinband. Erscheinungstermin 28. März 2025.
Die Fotografien und das Aquarell stammen vom Autor.
Bei dem Heisig-Foto von 1980 in der Ausstellungsvitrine handelt es sich um eine Aufnahme von Helfried Strauß.